-

Danke! - aus dem Senegal
Aus dem Senegal hat uns zu Jahresbeginn ein Dankesschreiben erreicht. Auch dank Ihrer Spenden konnten das Internat Salemata und die 60 Schüler:innen der Wohnheime Ethiolo, Oubadji und Kevoye ein weiteres Jahr lang verpflegt, versorgt und unterrichtet werden. Unsere Spendenaktion auf der Website betterplace.org unter dem Motto „Édethia édo mache: Unterstützt das Internat in Salemata!“ geht auch 2026 weiter.
Mehr lesen Zum Archiv -
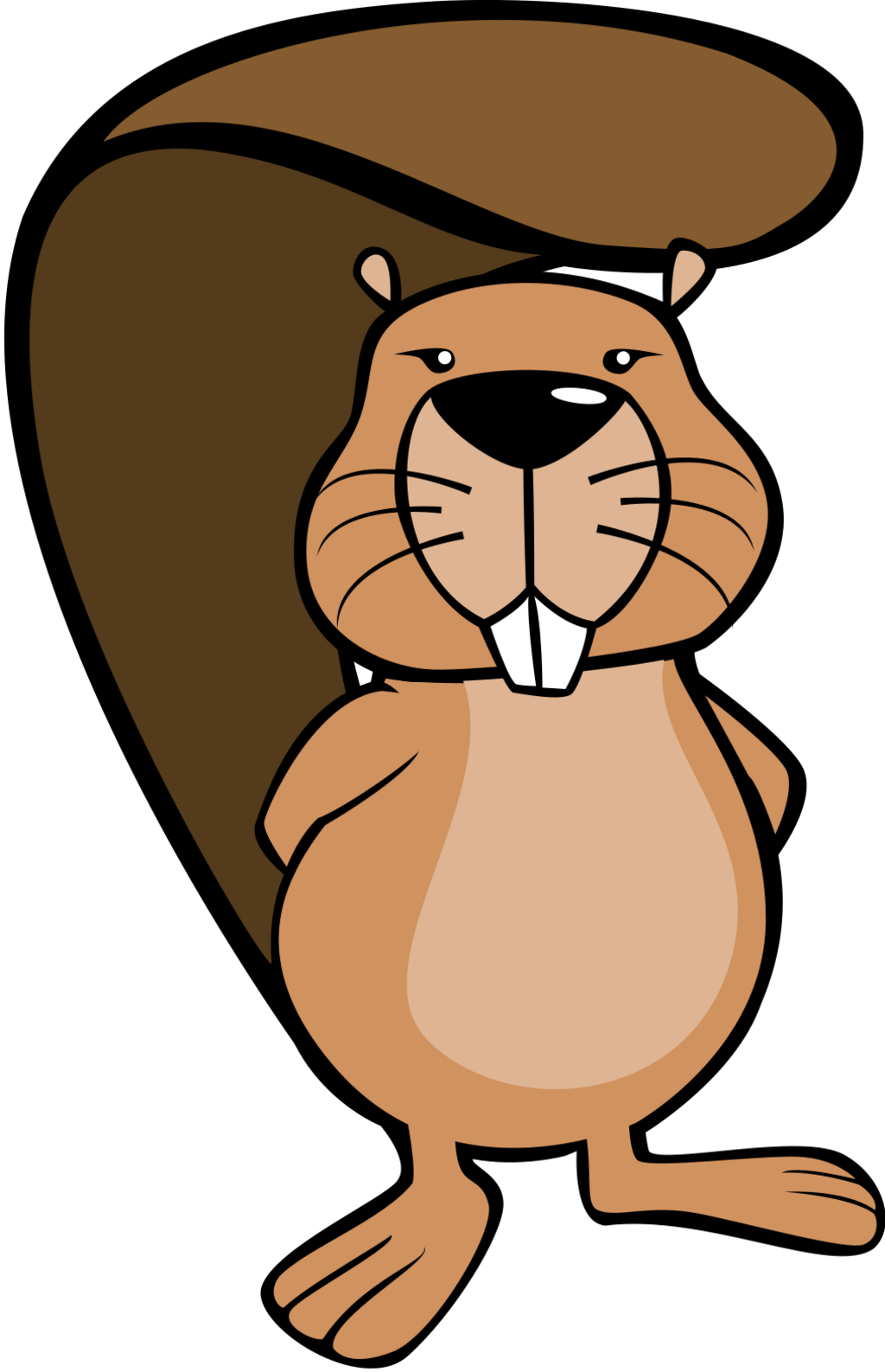
156 Schülerinnen und Schüler des HAG überzeugen beim Informatik-Biber
Der Informatik-Biber ist ein jährlich im November stattfindender Wettbewerb, mit dem Ziel, das Interesse an Informatik zu wecken und die Vielseitigkeit und Bedeutung der Informatik aufzuzeigen. In der Zeit vom 10.11 – 21.11.2026 war es soweit: 156 Schülerinnen und Schüler aus den Stufen 5 bis 11 des HAG haben mit großem Engagement am Informatik-Biber-Wettbewerb teilgenommen.
Mehr lesen Zum Archiv
Physik
Im Physikunterricht erfahren die Schülerinnen und Schüler beispielhaft, in welcher Weise und in welchem Maße ihr persönliches und das gesellschaftliche Leben durch Erkenntnisse der Physik mitbestimmt werden. Der Aufbau eines physikalischen Grundverständnisses in ausgewählten Bereichen ermöglicht ihnen, Entscheidungen und Entwicklungen in der Gesellschaft im Bereich von Naturwissenschaft und Technik begründet zu beurteilen, Verantwortung beim Nutzen des naturwissenschaftlichen Fortschritts zu übernehmen, seine Folgen abzuschätzen sowie als mündige Bürger auch mit Experten zu kommunizieren.
„Der Inhalt der Physik geht die Physiker an, die Auswirkung alle Menschen.“
(Aus „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt)
Physikalische Erkenntnis gründet sich in naturwissenschaftlicher Beobachtung der Welt. Der Physikunterricht vermittelt dabei Erfahrungen mit wesentlichen Elementen naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen, indem von den Schülerinnen und Schülern formulierte Vermutungen oder Hypothesen in eigenen, qualitativ und auch quantitativ auswertbaren Experimenten überprüft werden. Bei selbständigem Experimentieren erfahren die Lernenden, wie wesentlich genaues Arbeiten und gewissenhafter Umgang mit Daten sind. Hierdurch werden erste fachliche Kriterien zur Bewertung wissenschaftlicher Ergebnisse bereitgestellt und eine naturwissenschaftliche Grundbildung vermittelt.
Besuch außerschulischer Lernorte

Außerschulische Lernorte schaffen Räume und Lerngelegenheiten in einer offenen und realitätsbezogenen Umgebung, die mit authentischen und lebensweltlichen Kontexten einen weiteren Zugang zu physikalischen Problemstellungen bietet. Schülerlabore als etablierte außerschulische Lernorte steigern nachweislich das Interesse, die Motivation und das Selbstkonzept bezüglich des Unterrichtsfachs Physik – insbesondere auch von Mädchen. Darüber hinaus erhalten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in Berufsbilder und Studiengänge im Bereich der Physik und Technik. Am Hannah-Arendt-Gymnasium werden daher folgende Schülerlabore besucht:
Jahrgang 8 | Jahrgang 10 |
Schülerlabor: Niedersächsische Lernwerkstatt für solare Energiesysteme am Institut für Solarenergieforschung Hameln (NILS-ISFH)
| Schülerlabor: TechLab der Leibniz Universität Hannover
|
Im Rahmen des Physikunterrichts im 8. Jahrgang und der Unterrichtseinheit zu Elektrizität werden alle Schülerinnen und Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums Barsinghausen das Schülerlabor „Niedersächsische Lernwerkstatt für Solare Energiesysteme“ (NILS) des Instituts für Solarenergieforschung Hameln. Während des Besuchs werden die Klassen in mehrere Gruppen aufgeteilt und durchlaufen folgende Stationen: Ein Bestandteil ist eine 90-minütige Führung durch die Forschungsbereiche und Anlagen des Instituts, um Einblicke in aktuelle Forschungsthemen und wissenschaftliches Arbeiten zu erlangen. In der zweiten Station bauen und löten die Lernenden unter Anleitung eigene Solarmodule, mit denen sie verschiedene Experimente durchführen und zum Beispiel Handys mit Sonnenenergie aufladen. Der dritte Baustein besteht aus einem Theorieteil zu Solarzellen und Experimenten mit fertigen Modulen aus dem Schülerlabor.
Die selbstgebauten Module werden anschließend im Physikunterricht des Jahrgangs 8 und 10 weiter eingesetzt, um Themen wie Strom, Spannung, Leistung und Halbleiter anschaulich zu vermitteln.
Differenzierung
Die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern im modernen Physikunterricht weist von sich aus bereits viele Charakteristika differenzierten Lernens auf. Diese Differenzierung kann bewusst gefördert werden, zum Beispiel durch:
Kooperative Lernformen | Abgestufte Lernhilfen | Hilfesystemen in offenen Lernformen (z.B. Lernen an Stationen) |
Projektorientiertes Arbeiten | Offene Lernformen (Lernaufgaben, offene Aufgabenstellungen, Arbeitspläne) | Lernen an Stationen |
Lernen durch Lehren | Lernaufgaben in unterschiedlichen Leistungsniveaus | Offenes Arbeiten (schülergerechtes Experimentiermaterial, Computer, Recherche) |
Stärkung des eigenverantwortlichen Lernens durch Selbst- und Fremdreflexion | Angebote auch für SuS mit praktischen Fähigkeiten (Baukästen, Experimentierkästen, Löten, Schülerexperimente (auch als häusliche Experimente)) | Bildung von leistungshomogenen oder leistungsdifferenzierten Arbeitsgruppen |
Experimental-Abitur

Am Hannah-Arendt-Gymnasium kann die Abiturprüfung im Fach Physik als experimentelles Abitur abgelegt werden. Dabei haben die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses (erhöhtes Niveau) die Möglichkeit, ihre experimentellen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Grundlage sind drei standardisierte Experimentierkästen, die zu den Themengebieten Elektrizität, Optik und Atomphysik sowie Schwingungen und Wellen allesamt am HAG zur Verfügung stehen.
Der Physikunterricht am HAG ist stark experimentell ausgerichtet – Experimente stehen regelmäßig im Zentrum des Unterrichts. Bereits im Unterricht und in Übungsklausuren können die Lernenden daher unter realitätsnahen Bedingungen mit Einzelbeleuchtung und abgedunkelten Fenstern mit den Kästen experimentieren. Genutzt werden dort etwa Leuchtdioden, optische Gitter und stehende Seilwellen.
Neben dem Experimentieren bleiben auch klassische Elemente wie Herleitungen, Berechnungen, Erklärungen und Deutungen prüfungsrelevant, sodass sich Elemente der theoretischen Physik und vor allem der Experimentalphysik in Klausuren widerspiegeln.
Medieneinsatz im Physikunterricht
In den Klassenstufen 8 bis 10 erfolgt die Einführung zur Nutzung des Computer-Algebra-Systems GeoGebra im Physikunterricht für einfache Berechnungen und zur Auswertung von Messreihen. Dazu gehören die graphische Darstellung, Regression und Untersuchung auf Produkt- und Quotientengleichheit. Ab dem Schuljahr 2024/2025 erfolgt die weitergehende Einführung und Nutzung des Computer-Algebra-Systems GeoGebra im Physikunterricht des Jahrgangs 11 und sukzessive aufsteigend mit den folgenden Schuljahren.
In der Klassenstufe 8 und 11 kann Videoanalyse angewendet werden, um Bewegungstypen quantitativ zu untersuchen.
Im Jahrgang 9 im Themenkomplex „Atom- und Kernphysik“ sind umfangreiche Präsentationen vorgesehen. Der Schwerpunkt liegt auf der Präsentationsgestaltung unter Einsatz digitaler Werkzeuge mit dem Ziel der Vermittlung und Visualisierung naturwissenschaftlicher und technischer Zusammenhänge.


